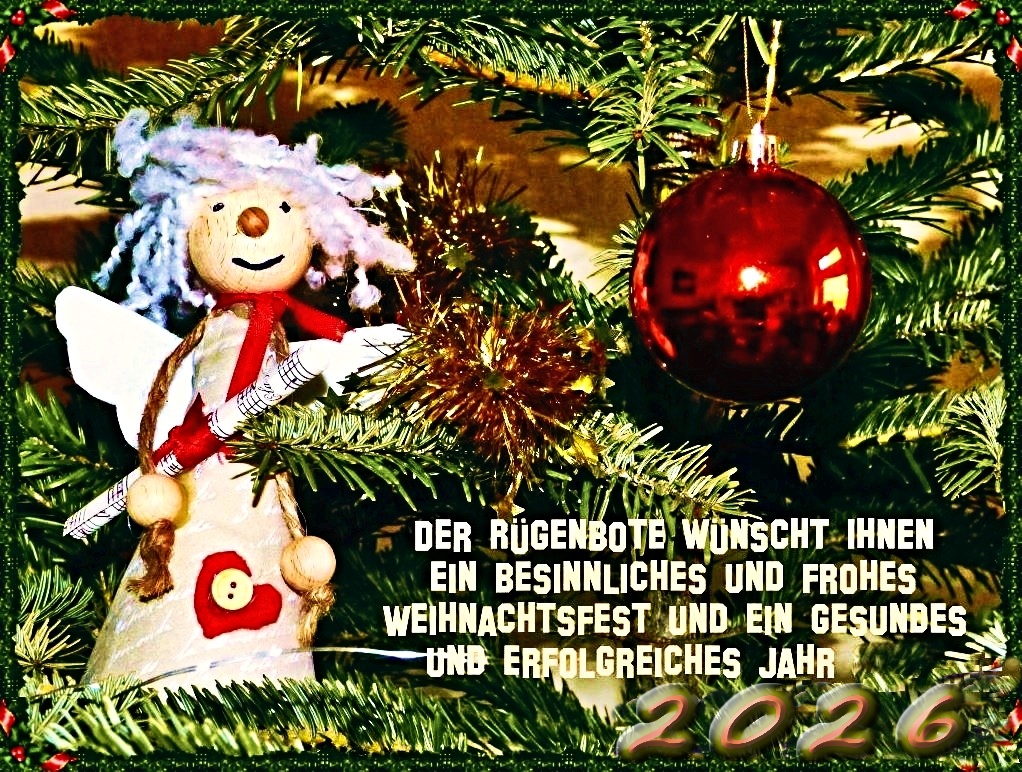Schwerin – Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Auszahlung zentraler EU-Agrarfördermittel fristgerecht auf den Weg gebracht. Sowohl die Direktzahlungen der ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) als auch die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (AUKM) der zweiten Säule wurden termingerecht an die landwirtschaftlichen Betriebe ausgezahlt. Insgesamt profitieren die Betriebe im Land von Fördermitteln in Höhe von rund 396 Millionen Euro.
Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus betont die Bedeutung der pünktlichen Zahlungen für die Betriebe: „Die fristgerechte Auszahlung der EU-Agrarfördermittel ist ein wichtiges Signal an unsere Landwirtinnen und Landwirte. Sie schafft Verlässlichkeit und Planungssicherheit – gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher und klimatischer Herausforderungen. Ich danke allen Betrieben, die sich mit ihrem Engagement für Umwelt-, Klima- und Artenschutz starkmachen.“
Zum Jahresende 2025 wurden in Mecklenburg-Vorpommern Direktzahlungen der ersten GAP-Säule in Höhe von rund 309,6 Millionen Euro an fast alle Antragsteller ausgezahlt. Davon entfallen rund 199 Millionen Euro auf die „Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit“. Weitere 91,1 Millionen Euro werden für freiwillige Umweltleistungen im Rahmen der Öko-Regelungen bereitgestellt, die insbesondere dem Umwelt-, Klima- und Wasserschutz dienen. Zusätzlich fließen 5,4 Millionen Euro in die gekoppelten Tierprämien.
Nach Planung der auszahlenden Bundeskasse werden die Mittel – abhängig von den Buchungszeiten der jeweiligen Empfängerbanken – ab dem 29. Dezember 2025 auf den Konten der Begünstigten wertgestellt.
Im Vergleich zum Vorjahr wurden bei der Einkommensgrundstützung aufgrund der Absenkung des Prämiensatzes um ca. fünf Euro pro Hektar rund acht Millionen Euro weniger ausgezahlt. Gleichzeitig konnten jedoch fast sechs Millionen Euro mehr über die Öko-Regelungen akquiriert werden. Insgesamt liegen die Direktzahlungen damit rund drei Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau.
Bereits zum 30. Juni 2025 erhielten die landwirtschaftlichen Betriebe zudem rund 86 Millionen Euro aus den Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (AUKM) der zweiten GAP-Säule für das Verpflichtungsjahr 2024. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes.
Die Auszahlung erfolgte in allen Fällen, in denen keine offenen, noch zu klärenden Sachverhalte vorlagen. Insgesamt wurden bis Ende Juni 2.132 Antragsteller mit 3.537 bewilligten Anträgen berücksichtigt. Besonders stark nachgefragt waren die Programme „Extensive Dauergrünlandbewirtschaftung“, „Ökologischer Landbau“ und „Vielfältige Kulturen“, auf die zusammen mehr als 85 Prozent der verausgabten Mittel entfielen.
Minister Backhaus würdigt das Engagement der Betriebe ausdrücklich: „Unsere Landwirtinnen und Landwirte leisten einen unverzichtbaren Beitrag für Klimaschutz, Artenvielfalt, sauberes Wasser und hochwertige Lebensmittel. Dass so viele Betriebe an den Agrarumweltprogrammen teilnehmen, zeigt, wie ernst sie diese Verantwortung nehmen.“